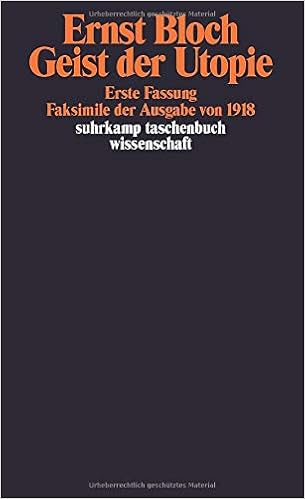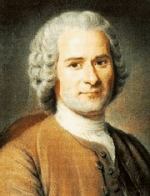Die Romantik ist eine kulturgeschichtliche Epoche, die vom Ende des 18. Jahrhunderts bis weit in das 19. Jahrhundert hinein dauerte und sich insbesondere auf den Gebieten der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik äußerte, aber auch die Gebiete Geschichte.
Die Romantik ist eine neue, tiefgehendere Form in der Literatur, die das Unterbewusstsein weckt und versucht Sehnsüchte zum Vorschein zu bringen, die vorher verborgen lagen.
Die Romantik ist die völlige Poetisierung des Lebens, zugleich aber auch eine ungeahnte Erweiterung der subjektiven Einfühlungs- und Erlebniskraft, die alle erstarrten Überlieferungen neu belebt.
Harmonie, Geheimnis und Liebe sind Bestandteile eines großen Ganzen. Die Romantik ist eine Zeit der Sehnsucht junger Autoren, die Halt in der Natur, der Vergangenheit und der Spiritualität suchen.
Die Grundthemen der Romantik sind Gefühl, Leidenschaft, Individualität und individuelles Erleben sowie Seele, vor allem die gequälte Seele. Romantik entstand als Reaktion auf das Monopol der vernunftgerichteten Philosophie der Aufklärung und auf die Strenge des durch die Antike inspirierten Klassizismus. Im Vordergrund stehen Empfindungen wie Sehnsucht, Mysterium und Geheimnis.
Die Romatiker verspürten den Drang, dem aufkommenden und entzaubernden Empirismus und Rationalismus etwas entgegenzusetzen. Der deutsche Idealismus ist der Versuch, den Dualismus von Empirismus und Rationalismus zu überwinden und die Romantiker geben diesem Vesuch einen besonderen Akzent. Die einen betonen das Sittliche (Schiller, Fichte, Hegel), die anderen, Romantiker wie Novalis und Schlegel das Ästhetische.
Sie mobilisieren die Phantasie, und zwar nicht als bloße Ergänzung, sondern als Zentralorgan des Weltverständnisses und der Weltbildung. DiePhantasie ist die Macht! Es gilt, die Welt zu durchdringen mit poetischem Geist!
Der deutsche Idealismus folgte auf die Aufklärung.em in die Zukunft gerichteten Rationalismus und Optimismus der Aufklärung wird ein Rückgriff auf das Individuelle und Numinose gegenübergestellt. Diese Charakteristika sind bezeichnend für die romantische Kunst und für die entsprechende Lebenseinstellung.
Der Romantiker ortet einen Bruch, der die Welt gespalten habe in die Welt der Vernunft, der „Zahlen und Figuren“ (Novalis), und die Welt des Gefühls und des Wunderbaren. Treibende Kraft der deutschen Romantik ist eine ins Unendliche gerichtete Sehnsucht nach Heilung der Welt, nach der Zusammenführung von Gegensätzen zu einem harmonischen Ganzen.
Symbolische Orte und Manifestationen dieser Sehnsucht sind nebelverhangene Waldtäler, mittelalterliche Klosterruinen, alte Mythen und Märchen, die Natur etc. Zentrales Symbol für diese Sehnsucht und deren Ziel ist die Blaue Blume, die wie kein anderes Motiv die romantische Suche nach innerer Einheit, Heilung und Unendlichkeit verkörpert.
|
Die sittlichen Werte und Ziele bestehen darin, sich selbst ohne Maske und Lügen zu leben.
Romantik ist mit der Mystik im tiefsten Wesen verwandt. Sie ist Gegner der Aufklärung: Das Verständliche, Begreifliche, Nützliche, Praktische ist ihr das Unwirkliche, Wesenlose. Nur im Leben der Idee ist die wahre Wirklichkeit.
Jeder Romantiker ist auch Philosoph. Jedoch bewegten sich die Romantiker mit vorlieben auf der Grenzscheide zwischen Philosophie und Dichtung. Philosophie und Dichtung fließen zu einem Ganzen zusammen. Dies bedeutet jedoch oft, daß die Philosophie symbolisch verschwimmt, die Dichtung gedanklich-metaphysisch überlastet wird. Ausnahmen sind die eigentlichen Philosophen wie Schelling und Schleiermacher. Hegel wächst über die Romantik weit hinaus.
Alle Spontanität liegt nach Fichte in der produktiven Einbildungskraft. Das Schaffen der Dichtung wurzelt in allen Umständen in ihr, es ist der Brennpunkt der Romantik. Das Seelenleben ist unerschöpflicher Formenreichtum. Diese Ichkonzentration bringt ein Feingefühl für fremde Geistesart mit sich. Dies erklärt die sich entwickelnde Literatur- und Geistesgeschichte in dieser Zeit.
Weblink:
Die Philosophie der Romantik - www.epischel.de