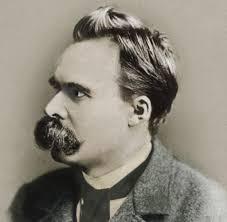Friedrich Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Leipzig als Sohn eines evangelischen Pfarres geboren. Nietzsche gilt als einer der bedeutendsten und einflussreichsten Denker aller Zeiten. Der Relgionskritiker entwickelte eine neue Morallehre und eine eigene
Philosophie, die den willen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Nietzsche gilt ala unzeitgemäßer Philosoph, der mit dem Hammer philosophierte und dabei bestehende Moralvorstellungen zertrümmerte.

1870 wurde
Friedrich Nietzsche mit 25 Jahren und noch ohne Promotion als Professor nach Basel berufen. Mit seinem ersten Buch "Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik" (1871) erregte er einen handfesten Skandal, welcher seine akademische Karriere ruinierte. Darin verherrlichte er das tragische Lebensgefühl und feierte den umstrittenen Komponisten und Operndichter Richard Wagner als Neubegründer der deutschen Kultur.
Nietzsche, dessen Stil durch den Gebrauch von Aphorismen und Metaphern geprägt ist, war ein scharfer Religionskritiker. Sein Ziel war es, die Hintergründe und Motive, die die Grundlage der westlichen
Philosophie,
Kunst und
Kultur bilden, freizulegen und zu interpretieren. Seine Philosophie in der Tradition der Aufklärung war eine Abrechnung mit den tradierten Moralvorstellungen des Christentums.
Seine Haltung kommt durch seinen berühmten Satz »Gott ist tot« gut zum Ausdruck. Er propagierte die »Umwertung aller Werte« und die Schaffung eines "Übermenschen" anstelle des traditionellen Christentums. Als seine wohl wichtigste Schrift gilt sein vierbändiges Hauptwerk »Also sprach Zarathustra« (1883-1885). Weitere bedeutende Veröffentlichungen des Philosophen sind »Unzeitgemäße Betrachtungen« (1873-1876) und der nach seinem Tod erschienene Band »Der Wille zur Macht« (1901).
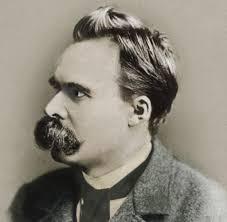
Nietzsche begann seine Laufbahn als Philologe, begriff sich selbst aber zunehmend als Philosoph oder als „freier Denker“. Er durchlief in seinen Werken auf dem Weg zum eigenständigen Denker einen Reifungs- und Emanzipationsprozeß: an dem er an die Stelle der Kunst die
Philosophie als den Gipfelpunkt der Kultur setzte und seine allmähliche Loslösung von seinen Vorbildern Arthur Schopenhauer und Richard Wagner betrieb.
Nietzsche hat wie kaum ein Zweiter mit den Lehrsätzen der Philosophie und Theologie aufgeräumt und abgrechnet. Mit der Kritik der Moral hängt eine Kritik bisheriger Philosophien zusammen. Sein Werk enthält scharfe Kritiken an
Moral,
Religion,
Philosophie,
Wissenschaft und Formen der
Kunst. Er kritisierte die überkommenen Werte der christlichen Moral und forderte eine Abkehr vom Christentum. In seinen Werken wandte sich der Moralphilosoph gegen die überkommenen christlichen Werte. Das Christentum lehnte er als eine Religion für die Schwachen ab.
Seine Philosophie betonte den Wert des Lebens für die Moral. Die Frage nach dem Wert der Moral für das Leben bildete eine Grundfrage seiner Moralkritik. Nach Nietzsche haben Menschen des »Ressentiment«, deren Wille sich gegen das Leben richtet, eine Moral, ein System von Werten erfunden, das ihnen über ihre Schwäche hinweghilft.
Der radikale Denker erhob den Menschen selbst zum Schöpfer und forderte einen neuen, vollkommenen höchsten Menschen - den »Übermenschen« als Verkünder einer neuen, höherwertigen Moral.
Nietzsche philosophierte mit dem Hammer und zertrümmerte bestehende Moralvorstellungen und entwickelte eine höhere Moral »Jenseits von Gut und Böse«. Der Philosoph sah im »Willen zur Macht« die Triebfeder allen Lebens. Ziel und Sinn aller Entwicklung war für Nietzsche der »Übermensch«.

Bekannt wurde Nietzsche auch für seine versierte Sprachschöpfung und die sprachlich anspruchsvolle Dichtkunst. Zu seinen bekanntesten - zumeist aphoristischen Werken - gehören »Also sprach Zarathustra«, »Genealogie der Moral«, »Jenseits von Gut und Böse«, »Menschliches, Allzumenschliches«.
Nietzsche beeinflusste durch sein vielseitiges Werk nachhaltig die Philosophie der Neuzeit. Er gilt als der einflussreichste Philosoph der Neuzeit. Grossen Einfluss übte er durch seinen Ansatzpunkt, den Menschen in den Mittelpunkt seiner Philosophie zu stellen, auf die spätere Existenzphilosopie aus.
Friedrich Nietzsche bot mit seiner Philosophie Perspektiven in zweifacher Hinsicht an. Zum einen bot er einen Gegenentwurf zu den Erlösungs- und Heilsvorstellungen der Religion an. Zum anderen entwickelte er eine Utopie der Selbstverantwortung des Menschen - repräsentiert durch den Übermenschen.
Selten hat jemand einen so hohen Preis für sein Genie bezahlt. Bereits im Alter von 45 Jahren kam es endgltigen Zusammenbruch, dem sich ein letztes Lebensjahrzehnt in geistiger Umnachtung anschloss.
Weblinks:
-
- www.die-biografien.de
-
- www.die-zitate.de
Friedrich Nietzsche - philosophiestudium.blogspot.com
Friedrich Nietzsche-Werke:

Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche

Ecce Homo - Sonderausgabe

Genealogie der Moral

Zarathustra

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik














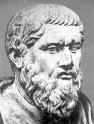
 Plotin und der Neuplatonismus
Plotin und der Neuplatonismus Plotin und der Neuplatonismus
Plotin und der Neuplatonismus