
Menschliches, Allzumenschliches, I und II
»Menschliches, Allzumenschliches, I und II« von Friedrich Nietzsche und Mazzino Montinari ist der x-Band der Reihe ...
Friedrich Nietzsche schaffte sich seinen freien Geist, als eine Erholung und Ablenkung nach einem entzaubernden, entromantisierenden Blick in das Innere der Welt, um die daraus resultierenden Wahrheiten zu ertragen, aber gleichzeitig auch überwinden und bejahen zu können. Wir lesen hier einen Friedrich Nietzsche, der sich in einem gewandelten und weiterentwickelten Zustand befindet, der durch die nötige Distanz und Ferne zu seinen aufdeckenden Erfahrungen, einen kühleren und gefestigteren Blick eingenommen hat, um sie endlich geordnet darzustellen. In seinem späteren Werk, "Also sprach Zarathustra" , ist die Rede "Von den drei Verwandlungen", in denen differenziert wird zwischen dem Kamel-Stadium, das den gebundenen, folgsamen Geist darstellt, dem anschließenden Löwen-Stadium, welches den befreienden Geist hervorbringt und dem letzten Stadium des Kindes, wo der neue werteschaffende Geist, seine bisherigen Stadien überwunden und sie als seine Geschichte zurückgelassen hat.
Der uns vorliegende Nietzsche, der sich durch eine antreibende Neugier zu einem entsagenden Aufbruch auszeichnet, um sich von sämtlichen Sinngebungen und Glaubenssätzen loszulösen, spiegelt dementsprechend eine Zugehörigkeit zum Stadium des Löwen wieder. Mit dem Pathos "lieber sterben als hier leben" hat er sich nun genügend Selbstvertrauen aufgebaut um den Mut für eine konsequente Durchführung einer Umwertung der Werte anzutreten und den langen Weg zum selbstbestimmenden Freigeist zu ebnen. In Menschliches Allzumenschliches werden noch keine neuen Werte verkündet, sondern es wird eine medizinische Anleitung in Form eines Übergangsprozess geliefert, um die trübe, nebelige Sicht des gebundenen Geist zu erhellen und ihn stattdessen durch die klareren Augen des ungebundenen Freigeistes blicken zu lassen. Mit den Worten "Du solltest Herr über dich werden, Herr auch über die eigenen Tugenden", bläst er den Kampf für eine Selbstbestimmung an, die sich von der bisherigen Fremdbestimmung endlich distanzieren soll, um das Perspektivische in jeder Wertschätzung begreifen zu lernen, wie es Nietzsche in der Vorrede erläutert. Es hieß Abschied nehmen von seinen großen Vorbildern, Schopenhauer und Wagner, um Platz für sein neues Ideal, den Freigeist zu schaffen.
Doch wer neues schaffen will, muss altes zerstören und darum gilt es die vielschichtigen Irrwege der gebundenen Geister, in sämtlichen Regionen der menschlichen Interaktionen aufzuzeigen. So in der Religion, den moralischen Empfindungen, der Metaphysik, aber auch im kleinen Rahmen, wie der Ehe und in der Beziehung zwischen der Mutter und ihrem Kind. Dem gebundenen Geist fehlt die differenzierte Einsicht in die Wahl der vielen Möglichkeiten, stattdessen erblickt er seine Stellung durch einen Tunnelblick, um die bequemere Gewohnheit, der Qual der Wahl vorzuziehen. Auf diese Weise handelt er nach seinen anerzogenen Maximen, die seine Handlungsfreiheit auf wenige Möglichkeiten einschränkt, im Gegensatz zum Freigeist, der sich der Mannigfaltigkeit der Motive und Gründe bewusst ist. Das Einverleiben geistiger Standpunkte, die unreflektiert akzeptiert werden, bezeichnet Nietzsche als Glauben. Nach diesem Schema funktionieren auch die Pfeiler der Gesellschaft, die ihre Legitimation durch den bequemen Glauben an sie erlangen. Der gebundene Geist ist mit dem Nutzen den sie bringen zufrieden und sieht die staatliche Ordnung und die Moral, als feststehende Wahrheiten an.

Menschliches, Allzumenschliches, I und II
Doch wie vermag der Freigeist zu handeln und sich durchzusetzen, wenn er vor lauter Gründe nur noch Abgründe erkennt, die sein Handeln so erschweren und ihn daher schwach erscheinen lassen. Dazu der Schmerz, der sich durch einen Verlust an gesellschaftlicher Integrität und der daraus resultierenden Verkanntheit bemerkbar macht, verleiten zu einem harten und einsamen Schicksal. Woher kommt der Glaube an das eigene Genie und die Kraft, " eine ganz individuelle Erkenntnis der Welt zu erwerben " und sich dadurch gegenüber den gebundenen Geistern zu behaupten ?, fragt sich Nietzsche. Der Freigeist muss sich nach langer Enthaltsamkeit befreien können, damit seine angestaute Energie sich endlich entladen und womöglich etwas Neues, noch nie dagewesenes erschaffen kann. Der gebundene Geist, so kritisiert Nietzsche, tritt lediglich als Gattungswesen in Form von Beamten, Kaufleuten und Gelehrten auf, wodurch der Wert der Individualität verloren geht, doch dieser bedarf es gerade, um das Fundament des Freigeistes garantieren zu können.
»Man nennt den einen Freigeist, welcher anders denkt, als man von ihm auf Grund seiner Herkunft, Umgebung, seines Standes und Amtes oder auf Grund der herrschenden Zeitansichten erwartet. Er ist die Ausnahme, die gebundenen Geister sind die Regel; diese werfen ihm vor, daß seine freien Grundsätze ihren Ursprung entweder in der Sucht aufzufallen haben, oder gar auf freie Handlungen, das heißt auf solche, welche mit der gebundenen Moral unvereinbar sind, schließen lassen. Bisweilen sagt man auch, diese oder jene freien Grundsätze seien aus Verschrobenheit und Überspanntheit des Kopfes herzuleiten; doch spricht so nur die Bosheit, welche selber an das nicht glaubt, was sie sagt, aber damit schaden will: denn das Zeugnis für die größere Güte und Schärfe seines Intellekts ist dem Freigeist gewöhnlich ins Gesicht geschrieben, so lesbar, daß es die gebundenen Geister gut genug verstehen. Aber die beiden andern Ableitungen der Freigeisterei sind redlich gemeint; in der Tat entstehen auch viele Freigeister auf die eine oder die andere Art. Deshalb könnten aber die Sätze, zu denen sie auf jenen Wegen gelangten, doch wahrer und zuverlässiger sein als die der gebundenen Geister. Bei der Erkenntnis der Wahrheit kommt es darauf an, daß man sie hat, nicht darauf, aus welchem Antriebe man sie gesucht, auf welchem Wege man sie gefunden hat.«
Friedrich Nietzsche, »Menschliches, Allzumenschliches«
In "Menschliches Allzumenschliches" schreitet er nun schonungslos, sämtliche Gebiete menschlicher Aktivitäten ab und versucht im aphoristischen Stil aufzuzeigen, dass diese keine festen, allgemeingültigen Vorstellungen, sondern prozesshafte, sich im Verlauf der Geschichte verändernde Wahrheiten sind. So fordert er eine historische Philosophie, die sich genealogisch mit der Entstehung menschlicher Vorstellungen auseinandersetzt, um dadurch die verschiedenen Erkenntnisperspektiven freizulegen. Doch dieser Weg bedarf Zeit und einer Tilgung metaphysischer Restbestände, um den Weg für die Wissenschaft offenzulegen, so das die Frucht nun selbst vom Baum gepflückt werden kann, um die Möglichkeit des Fortschrittes zu gewähren. Für Nietzsche ist nun nicht mehr die Kunst, jenes erlösende Reich, sondern eine neue Art der wissenschaftlichen Kultur.
In "Also sprach Zarathustra" wird mit dem gleichnamigen Protagonisten ein Beisspiel für einen Freigeist gegeben, der nach langer Enthaltsamkeit gelernt hat, die Menschen jenseits von Gut und böse zu betrachten. Als dieser jedoch auf die gebundenen Geister trifft und er seine gewonnenen Erfahrungen kundtun möchte, haben diese nur Verachtung für ihn übrig, denn wer möchte schon seine aufgenommenen Wahrheiten, allesamt für nichtig erklärt bekommen. Ähnlich ergeht es auch dem sich befreienden Gefangenen aus Platons Höhlengleichnis, als dieser mit der Erkannten Wahrheit zu den anderen Gefangenen zurückkehrt und diese ihn nur auslachen. Es gehört zum Schicksal des Freigeistes abgestoßen und belacht zu werden, so dass es nicht verwunderlich erscheint, dass Nietztsche sich zeitlebens unverstanden gefühlt hatte.
Literatur
[ >> ] ::

Menschliches, Allzumenschliches, I und II von Friedrich Nietzsche und Mazzino Montinari

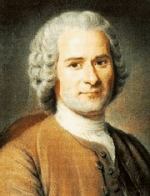


 Guillaume Martin, geboren 1993, gehört als Radprofi zur Weltspitze und ist zugleich Absolvent eines Masterstudiengangs in Philosophie an der Université Paris-Nanterre. 2019 und 2020 fuhr er bei der »Tour de France« jeweils in die Top 12 der Gesamtwertung, bei der »Vuelta a España« 2020 gewann er die Bergwertung. Auch als Autor hat er sich bereits einen Namen gemacht: Er ist Kolumnist für die Tageszeitung »Le Monde« und hat das Theaterstück »Platon vs. Platoche« verfasst, das vom »Théâtre de la Boderie« aufgeführt wurde.
Guillaume Martin, geboren 1993, gehört als Radprofi zur Weltspitze und ist zugleich Absolvent eines Masterstudiengangs in Philosophie an der Université Paris-Nanterre. 2019 und 2020 fuhr er bei der »Tour de France« jeweils in die Top 12 der Gesamtwertung, bei der »Vuelta a España« 2020 gewann er die Bergwertung. Auch als Autor hat er sich bereits einen Namen gemacht: Er ist Kolumnist für die Tageszeitung »Le Monde« und hat das Theaterstück »Platon vs. Platoche« verfasst, das vom »Théâtre de la Boderie« aufgeführt wurde. 











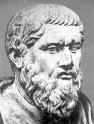







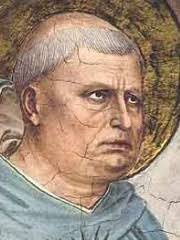




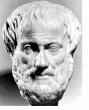

 <;br>Die Fröhliche Wissenschaft
<;br>Die Fröhliche Wissenschaft

