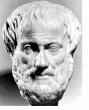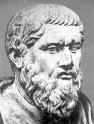In Bezug auf die Erfahrung des Holocaust beschäftigte sich die politische Theoretikerin Hannah Arendt mit der Frage nach dem radikal Bösen und kam dabei zu unterschiedlichen Auffassungen in frühen Äußerungen und im späteren Verlauf ihrer Studien. In ihrem Denktagebuch hielt Arendt im Juni 1950 fest:
„Das radikal Böse ist das, was nicht hätte passieren dürfen, d. h. das, womit man sich nicht versöhnen kann, was man als Schickung unter keinen Umständen akzeptieren kann, und das, woran man auch nicht schweigend vorübergehen darf. Es ist das, wofür man die Verantwortung nicht übernehmen kann, weil seine Folgerungen unabsehbar sind und weil es unter diesen Folgerungen keine Strafe gibt, die adäquat wäre. Das heißt nicht, daß jedes Böse bestraft werden muss; aber es muss, soll man sich versöhnen oder von ihm abwenden können, bestrafbar sein.“[19] Das radikal Böse zeigt sich in diesem Splitter vor allen Dingen an seinen historisch-moralischen Folgen.
In einem Brief an Karl Jaspers aus dem März 1951 versuchte sie eine vorläufige Typisierung:
„Was das radikal Böse nun wirklich ist, weiß ich nicht, aber mir scheint, es hat irgendwie mit den folgenden Phänomenen zu tun: Die Überflüssigmachung von Menschen als Menschen (nicht sie als Mittel zu benutzen, was ja ihr Menschsein unangetastet läßt und nur ihre Menschenwürde verletzt, sondern sie qua Menschen überflüssig zu machen)“.
Die Bedingungen für das Auftreten des radikal Bösen verortete sie in ihrem politischen Hauptwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951 auf Englisch) im Anspruch der totalen Herrschaft, auch hinsichtlich ihrer Möglichkeiten (und nicht nur in Hinblick auf die Subsumption der gesamten Gesellschaft unter die Herrschaft) total zu sein:
„Aber in ihrem Bestreben, unter Beweis zu stellen, dass alles möglich ist, hat die totale Herrschaft, ohne es eigentlich zu wollen, entdeckt, dass es ein radikal Böses wirklich geben könne. Als das Unmögliche möglich wurde, stellte es sich heraus, dass es identisch ist mit dem unbestrafbaren, unverzeihlichen radikal Bösen, das man weder verstehen noch erklären kann durch die Motive von Eigennutz, Habgier, Neid, Machtgier, Ressentiment, Feigheit.“
Zwischen März und April 1953 notierte Arendt in ihr Denktagebuch: „Es gibt das radikal Böse, aber nicht das radikal Gute. Das radikal Böse entsteht immer, wenn ein radikal Gutes gewollt wird.“
In ihrem Bericht Eichmann in Jerusalem von 1963 entwickelte sie ihre Vorstellung von der „Banalität des Bösen“. Demnach war in der Herrschaftsstruktur des Nationalsozialismus das Böse allgegenwärtig, darauf zielend, den Menschen als Menschen abzuschaffen und nach und nach alle Menschen im Namen abstrakter Fortschrittsziele industriell zu vernichten, bis nur noch Funktionsträger der „organisierten Ohnmacht“ des totalitären Systems übrig bleiben. Doch auch diese Funktionsträger können jederzeit ausgewechselt werden, so dass sie letzten Endes nur als Funktion überleben, nicht aber als Personen. Da Eichmann in Jerusalem Gegenstand heftiger Vorwürfe wurde, die in Arendts Beschreibung eine Verharmlosung oder gar Entschuldigung des Holocaust durch soziologische Umstände sehen wollten, erklärte Arendt ihre Position schließlich noch einmal 1965 in einer Vorlesungsreihe, die unter dem Titel Über das Böse erst aus dem Nachlass veröffentlicht wurde.
Philosophenwelt-Blog gewährt Einblicke in die Welt der Philosophie. Dieser Blog bietet Ansichten und Einsichten zum Thema Philosophie. Der Philosophenwelt-Blog ist ein Philosophie Blog und Podcast zu aktuellen, aber auch klassischen Themen der Welt. Der aufklärerische Blog folgt dabei einer Kantschen Devise: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen." Immanuel Kant
Samstag, 25. Januar 2025
Hauptwerke von Nietzsches mittlerer Schaffensperiode

Morgenröte / Idyllen aus Messina / Die fröhliche Wissenschaft.
von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
Band 3 der Kritischen Studienausgabe enthält folgende, von Nietzsche selbst herausgegebene Werke: ›Morgenröthe. Gedanken über moralische Vorurtheile (1881). Neue Ausgabe mit einer einführenden Vorrede (1887)‹; ›Idyllen aus Messina (1882), ›Die fröhliche Wissenschaft (1882). Neue Ausgabe mit einem Anhange: ›Lieder des Prinzen Vogelfrei‹ (1887).
In diesem Band finden sich, abgesehen von ›Menschliches, Allzumenschliches‹, die Hauptwerke von Nietzsches mittlerer Schaffensperiode, auch bekannt als seine "positivistische" oder "aufklärerische Periode" nach seiner erfolgten Loslösung von der Philosophie Schopenhauers und seinem einstigen Vorbild Wagner.
Es sind die Werke der Zeit vor seiner Radikalisierung im Zuge der Hinwendung zum "Willen zur Macht" in seiner Spätphase welche wohl Nietzsches bleibenden Ruhm als konsequenter Aufklärer und bedeutendstem Moral- und Fortschrittskritiker der deutschen Sprache begründet haben. Radikal und konsquent wie kein Denker zuvor und nur wenige danach stellt Nietzsche sämtliche unserer bisherigen Gewissheiten und Überzeugungen in Frage und zeigt uns ihre innere Widersprüchlichkeit und Sinnlosigkeit auf.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/519zmOCiOcL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
"Gott ist tot!" verkündet Nietzsche jubilierend- und mit ihm sämtliche unserer bisherigen "Wahrheiten" und Überzeugungen. Nun bleibt uns nur noch alles Überlieferte in Frage zu stellen und auf den Trümmern unsere neuen Überzeugen und Wertesysteme zu errichten, die "Umwertung aller Werte" deutet sich hier bereits an. Nirgendwo sonst werden Nietzsches "Perspektivismus"- alle Erkenntnis ist subjektiv und standpunktabhängig- und "Nihilismus"- alle Werte und "Wahrheiten" können und müssen stets angezweifelt werden- so konsequent ausformuliert wie hier.
Da es daher keine allgemeingültigen und letztendlich "ewigen Wahrheiten" und Wertesysteme geben kann, sieht Nietrzsche den "Sinn" menschlichen Lebens im dauernden hinterfragen des überlieferten und Streben nach "Erkenntnis", der Mensch soll das Allgemeingültige nicht einfach hinnehmen sondern sich seine eigenen Meinungen und "Wahrheiten" bilden und sich so letztlich selbst überwinden lernen. Wie ein Künstler sein Kunstwerk, so soll letztlich auch der Einzelne lernen sein Leben selbst nach eigenem Willen zu gestalten.
Kants "Sapere aude! - Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" - hier wurde es konsequent und radikal zu Ende gedacht.
Literatur:

Morgenröte / Idyllen aus Messina / Die fröhliche Wissenschaft. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
Samstag, 18. Januar 2025
Die Bedeutung des Aristoteles in der Philosophie
Der griechische Philosoph Aristoteles lebte in den Jahren 384 bis 322 v. Chr. Seine Gedanken und seine Ethik sind jedoch auch in heutiger Zeit noch von großer Bedeutung und Tragweite.
Gemäß der Lehre des Aristoteles bildete sich eine ganze eigene philosophische Richtung, welche als »Aristotelismus« bezeichnet wird.
Die Gedanken von Aristoteles und sein Menschenbild werden in der heutigen Literatur immer wieder aufgeführt und diskutiert. Das Menschenbild ist sehr prägend.
Samstag, 11. Januar 2025
Sokrates war ein Weiser
Sokrates war ein Weiser, weil er seine Erkenntnisse über die Wichtigkeit eines tugendhaften Lebens nicht nur in seinen Dialogen, sondern vor allem in seinem Leben beispielhaft verkörpert hat.
Samstag, 4. Januar 2025
Friedrich Nietzsche und die Frage nach dem Sinn

Mit der Aufklärung geriet die religiöse Ordnung ins Wanken. Hatte Kant noch versucht die Metaphysik zu retten, so haben wir in Nietzsche einen Skeptiker vor Augen, der nichts mehr gelten läßt. Mit Nietzsche wird der Begriff "Nihilismus" und seine Aussage aus der »Fröhlichen Wissenschaft« verbunden: »Gott ist tot.«
»Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwahrend? Und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts! ... Gott ist tot!«
Schon früh spürte Nietzsche die Zerrissenheit der Wirklichkeit. In diesem Stadium verehrte er aber noch die kulturellen Leistungen der Vergangenheit. Er hielt die bildende Kunst und die Musik für eine "wohltätige Illusion", deren Spiel am Abgrund der Welt gerechtfertigt schien. Doch sein Glaube an die Kultur war im Verfall begriffen. Schärfer und radikaler analysierte er den Zustand seiner Zeit und den Verfall der Kultur.
»Die Zeit, in die wir geworfen sind", ist "die Zeit eines großen inneren Verfalles und Auseinanderfalles. Die Ungewißheit ist dieser Zeit eigen; nichts steht auf festen Füßen und hartem Glauben an sich«.
Das Nichtigwerden des in der moderne Kultur latenten Christentums, das scheinheilige Festhalten an Werten, an die man nicht mehr wirklich glaubt, nennt der Philososph Friedrich Nietzsche „Nihilismus“.
Für den Zustand der Zeit wählte Nietzsche den Ausdruck "Nihilismus". Diesen Nihilismus verstand Nietzsche als Konsequenz der abendländischen Geistesbewegung, als ein objektives Geschehen, dem sich niemand entziehen kann.
Literatur:
 <;br>Die Fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche
<;br>Die Fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche 
Morgenröte / Idyllen aus Messina / Die fröhliche Wissenschaft. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
Ziel und Zweck der Aufklärung (K)
Wie keine andere Denkrichtung will die Aufklärung durch bloße Anleitung zur Vernunft, Demokratie, Diskurs und Achtung von Anderen (durch Toleranz, Gleichbehandlung und Solidarität) niemandem eine Weltsicht aufzwingen, sondern ganz im Gegenteil vor dem Hereinfallen auf Dogmen bewahren. Stellvertretend dafür steht Immanuel Kants Leitspruch der Aufklärung: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“ Zugleich zielen diese Werte unzweifelhaft auf ein friedliches Zusammenleben in geordneten Bahnen. Sodann bleibt Raum für aufgeklärte Religiosität, Atheismus oder auch politischen Pluralismus auf dem Boden der Demokratie.
Aufklärung ist ein geschichtlich-philosophisches Phänomen.
Der Begriff Aufklärung, auch für das „Aufklären“ beliebiger Sachverhalte verwendet, bezeichnet seit etwa 1700 das gesamte Vorhaben, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Seit etwa 1780 bezeichnet der Begriff auch diese geistige und soziale Reformbewegung, ihre Vertreter und das zurückliegende Zeitalter der Aufklärung in der Geschichte Europas und Nordamerikas. Es wird meist auf etwa 1650 bis 1800 datiert. Aufklärung hat ihre ‚Unschuld' schon im Prozess ihres Entstehens im 18. Jahrhundert verloren .
Als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz, der Kampf gegen Vorurteile, die Hinwendung zu den Naturwissenschaften, das Plädoyer für religiöse Toleranz und die Orientierung am Naturrecht.
Gesellschaftspolitisch zielte die Aufklärung auf mehr persönliche Handlungsfreiheit (Emanzipation), Bildung, Bürgerrechte, allgemeine Menschenrechte und das Gemeinwohl als Staatspflicht. Viele Vordenker der Aufklärung waren optimistisch, eine vernunftorientierte Gesellschaft werde die Hauptprobleme menschlichen Zusammenlebens schrittweise lösen. Dazu vertrauten sie auf eine kritische Öffentlichkeit. Kritik an diesem „Vernunftglauben“ entstand seit etwa 1750 unter den Aufklärern selbst, dann
Die Aufklärung hat es im 18. und 19. Jahrhundert trotz zahlreicher Widerstände und Widersprüchen verstanden, im Blick auf die eigenen Leistungen und Pläne mit dem Ferment des Selbstzweifels überwiegend produktiv und vorwärtsstrebend umzugehen.
Wenn es wahr ist, daß Wissen Macht ist, so ist auch wahr, daß nicht jedes Wissen willkommen geheißen wird. Weil es nirgendwo kampflos zu besetzende Wahrheiten gibt und weil jede Erkenntnis ihren Ort im Gefüge von Vormächten und Gegenmächten wählen muß, erscheinen nu die Mittel, Erkenntnisse Geltung zu verschaffen, beinahe noch wichtiger als die Erkenntnisse selbst.
Da die Aufklärung ihren Anspruch, bessere Einsicht gegen ein sich blockierendes Bewußtsein durchzusetzn, nicht aufgeben kann, muß sie letztlich hinter dem Bewußtsein des Gegners operieren.
Mittel der Aufklärung ist die Ideologiekritik. Ideologiekritik geht von einer verblendeten Wahrnehmung der (gesellschaftlichen) Realität aus. Indem Ideologiekritik diese unterstellte Verblendung aufzudecken versucht, möchte sie den Zugang zu den wirklichen Verhältnissen freilegen.
Im Zentrum der Diskussion stehen Fragen einer weiterführenden Bestimmung der Aufklärung als Epochebegriff und/oder Menschheitsproblem angesichts einer "Dialektik der Aufklärung", die gerade am Beginn eines neuen Jahrtausends immer weitere Dimensionen in ihrer Ausfächerung zeigt bzw. erahnen lässt.
Aufklärung ist ein allumfassender und vielgestaltiger Denk- und Lernprozeß, der sich auf sämtliche Wissensgebiete erstreckt und Auswirkungen auf das Geistes- und Kulturleben und die Politik hat
Bestrebungen, das Wissen der Zeit mit neuen Bildungssystemen, neuer Pädagogik, durch Bücher und Journale in der Bevölkerung zu verbreiten, ergänzten die primär wissenschaftlichen Diskussionsfelder der Aufklärungsepoche. Die damaligen öffentlichen Diskussionen politischer und gesellschaftlicher Prozesse spielen eine zentrale Rolle in der aktuellen Definition der Aufklärung.
Das Verdienst der Aufklärung ist die Hinterfragung der bestehenden Verhältnisse und die Schaffung eines kritischen Bewußtseins.
Aufklärung ist nicht denkbar ohne die Personen, die; mit ihren Gedanken und Werken ihre Beiträge zu ihrer öffentlichen Verbreitung geleistet haben
Aufklärung ist eine Waffe der Aufklärer im Kampf gegen die bestehende Macht.
»Alle menschliche Einsicht ist zuende, sobald wir zu Grundkräften oder Grundvermögen gelangt sind.« Kant
Eine reaktionäre Welt, ausgerechnet als Demokratie und Republik verschleiert, in einer Zeit, wo Aufklärung doch so Not tut. Keine aufklärerische Geister wie Voltaire oder Rousseau, die gegen die reaktionäre Verhältnisse angeschrieben haben. Wo keine Aufklärung stattfindet, entsteht ein Ort der Reaktion. Keine Dichter, die schwelgend in die Romantik abschweifen. Arm das Land, da keine denkenden und die Realität reflektierenden Philosophen mehr hat!
Aufklärung ist ein geschichtlich-philosophisches Phänomen.
Der Begriff Aufklärung, auch für das „Aufklären“ beliebiger Sachverhalte verwendet, bezeichnet seit etwa 1700 das gesamte Vorhaben, durch rationales Denken alle den Fortschritt behindernden Strukturen zu überwinden. Seit etwa 1780 bezeichnet der Begriff auch diese geistige und soziale Reformbewegung, ihre Vertreter und das zurückliegende Zeitalter der Aufklärung in der Geschichte Europas und Nordamerikas. Es wird meist auf etwa 1650 bis 1800 datiert. Aufklärung hat ihre ‚Unschuld' schon im Prozess ihres Entstehens im 18. Jahrhundert verloren .
Als wichtige Kennzeichen der Aufklärung gelten die Berufung auf die Vernunft als universelle Urteilsinstanz, der Kampf gegen Vorurteile, die Hinwendung zu den Naturwissenschaften, das Plädoyer für religiöse Toleranz und die Orientierung am Naturrecht.
Gesellschaftspolitisch zielte die Aufklärung auf mehr persönliche Handlungsfreiheit (Emanzipation), Bildung, Bürgerrechte, allgemeine Menschenrechte und das Gemeinwohl als Staatspflicht. Viele Vordenker der Aufklärung waren optimistisch, eine vernunftorientierte Gesellschaft werde die Hauptprobleme menschlichen Zusammenlebens schrittweise lösen. Dazu vertrauten sie auf eine kritische Öffentlichkeit. Kritik an diesem „Vernunftglauben“ entstand seit etwa 1750 unter den Aufklärern selbst, dann
Die Aufklärung hat es im 18. und 19. Jahrhundert trotz zahlreicher Widerstände und Widersprüchen verstanden, im Blick auf die eigenen Leistungen und Pläne mit dem Ferment des Selbstzweifels überwiegend produktiv und vorwärtsstrebend umzugehen.
Wenn es wahr ist, daß Wissen Macht ist, so ist auch wahr, daß nicht jedes Wissen willkommen geheißen wird. Weil es nirgendwo kampflos zu besetzende Wahrheiten gibt und weil jede Erkenntnis ihren Ort im Gefüge von Vormächten und Gegenmächten wählen muß, erscheinen nu die Mittel, Erkenntnisse Geltung zu verschaffen, beinahe noch wichtiger als die Erkenntnisse selbst.
Da die Aufklärung ihren Anspruch, bessere Einsicht gegen ein sich blockierendes Bewußtsein durchzusetzn, nicht aufgeben kann, muß sie letztlich hinter dem Bewußtsein des Gegners operieren.
Mittel der Aufklärung ist die Ideologiekritik. Ideologiekritik geht von einer verblendeten Wahrnehmung der (gesellschaftlichen) Realität aus. Indem Ideologiekritik diese unterstellte Verblendung aufzudecken versucht, möchte sie den Zugang zu den wirklichen Verhältnissen freilegen.
Im Zentrum der Diskussion stehen Fragen einer weiterführenden Bestimmung der Aufklärung als Epochebegriff und/oder Menschheitsproblem angesichts einer "Dialektik der Aufklärung", die gerade am Beginn eines neuen Jahrtausends immer weitere Dimensionen in ihrer Ausfächerung zeigt bzw. erahnen lässt.
Aufklärung ist ein allumfassender und vielgestaltiger Denk- und Lernprozeß, der sich auf sämtliche Wissensgebiete erstreckt und Auswirkungen auf das Geistes- und Kulturleben und die Politik hat
Bestrebungen, das Wissen der Zeit mit neuen Bildungssystemen, neuer Pädagogik, durch Bücher und Journale in der Bevölkerung zu verbreiten, ergänzten die primär wissenschaftlichen Diskussionsfelder der Aufklärungsepoche. Die damaligen öffentlichen Diskussionen politischer und gesellschaftlicher Prozesse spielen eine zentrale Rolle in der aktuellen Definition der Aufklärung.
Das Verdienst der Aufklärung ist die Hinterfragung der bestehenden Verhältnisse und die Schaffung eines kritischen Bewußtseins.
Aufklärung ist nicht denkbar ohne die Personen, die; mit ihren Gedanken und Werken ihre Beiträge zu ihrer öffentlichen Verbreitung geleistet haben
Aufklärung ist eine Waffe der Aufklärer im Kampf gegen die bestehende Macht.
»Alle menschliche Einsicht ist zuende, sobald wir zu Grundkräften oder Grundvermögen gelangt sind.« Kant
Eine reaktionäre Welt, ausgerechnet als Demokratie und Republik verschleiert, in einer Zeit, wo Aufklärung doch so Not tut. Keine aufklärerische Geister wie Voltaire oder Rousseau, die gegen die reaktionäre Verhältnisse angeschrieben haben. Wo keine Aufklärung stattfindet, entsteht ein Ort der Reaktion. Keine Dichter, die schwelgend in die Romantik abschweifen. Arm das Land, da keine denkenden und die Realität reflektierenden Philosophen mehr hat!
Dienstag, 24. Dezember 2024
Die Mär vom Weihnachtsmann

Die Figur des Weihnachtsmanns, der in das Zauberreich der weißen Welt entführt, dürfte wohl zu den charmantesten Lügengestalten der Welt gehören, die um so mehr geglaubt werden, je unwahrscheinlicher sie daherkommen.
Da soll es also in der Weihnachtsnacht einen rot gekleideten Gabenbringer geben, der von weit her kommt und es schafft, dass Geschenke für Abermillionen Menschen nahezu zur selben Zeit unterm Weihnachtsbaum liegen. Sonderlich realistisch ist diese Mär nicht gerade. - »Zweifel ist der Weisheit Anfang«, sagte bereits René Descartes.
Aber sinnstiftend ist dieses Bild schon - und zwar nicht nur für Kinder, die zwischen Freude und Ehrfurcht hin und hergerissen am Heiligen Abend durch Schlüssellöcher schauen, um vielleicht doch einen Blick auf den unbekannten Geschenkebringer zu erhaschen, sondern auch für diejenigen, die eigentlich nicht mehr an ihn glauben. Unter dem grün geschmückten Weihnachtsbaum sind alle - groß und klein - am Weihnachstabend vereint.
Aber die alte Mär hat je auch etwas Anrührendes und tief Bewegendes. Rüttelt die anrührende Figur im roten Gewand und dem weißen Rauschebart doch an den Grundfragen der menschlichen Existenz: Wo kommt der Mensch her? Was treibt ihn um? Wo geht er hin? - Diese existenziellen Fragen wollen schließlich auch für den Weihnachtsmann geklärt sein!
Seinen Ursprung hat er vielmehr in der Figur des Heiligen Nikolaus. Ihm zu Ehren werden Kinder ab dem 14. Jahrhundert immer zum 6. Dezember beschenkt. Doch warum ausgerechnet er? In der Figur des Heiligen Nikolaus sind zwei historische Personen verschmolzen. Zum einen Nikolaus von Myra: Er lebte im dritten Jahrhundert und war Bischof einer Stadt in der heutigen Türkei. Die andere historische Person, die in der Figur aufgeht, ist Nikolaus von Sion aus dem sechsten Jahrhundert, der in einem Ort in der Nähe von Myra lebte.
Abonnieren
Kommentare (Atom)